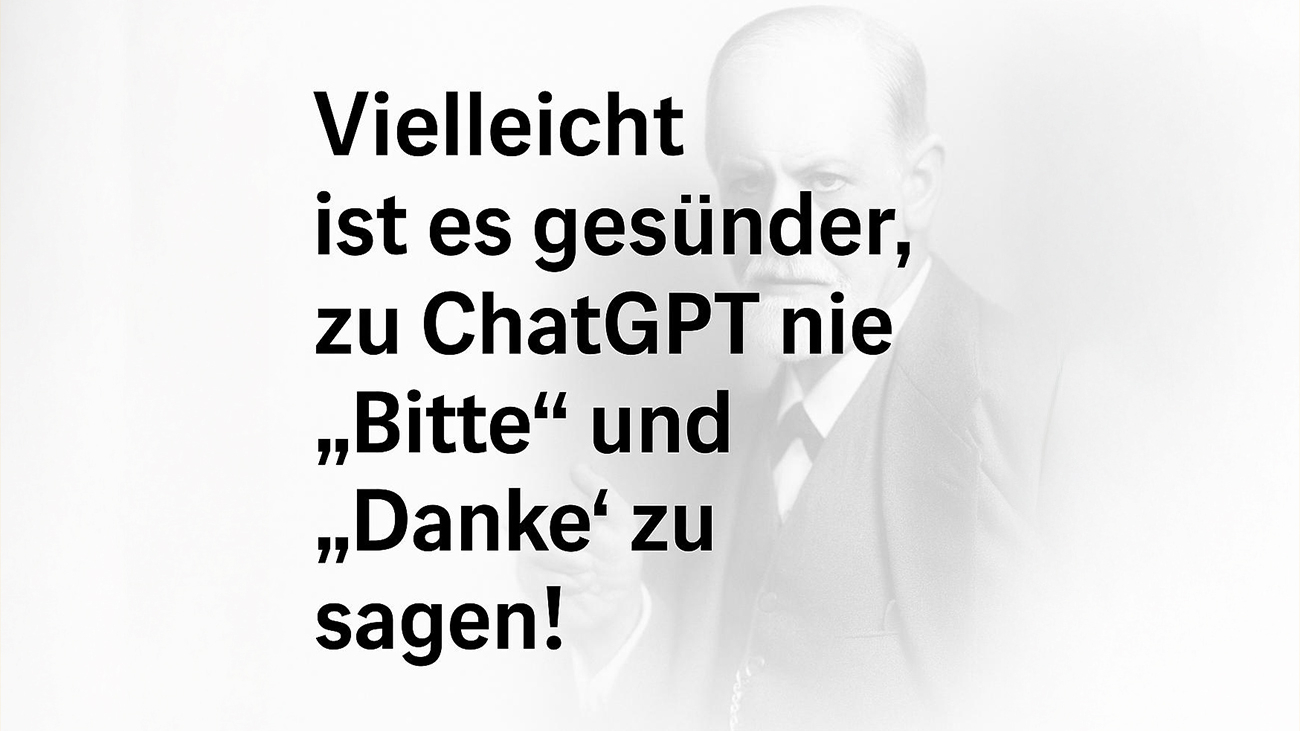Warum du zu ChatGPT nicht „Bitte“ und „Danke“ sagen solltest
Im ersten Teil habe ich auf LinkedIn erklärt, warum ich meine KI konsequent „Stupid Machine“ nenne und warum ich es vermeide, zu ChatGPT „Bitte“ und „Danke“ zu sagen.
Für den Leistungssport möchte ich das Thema nun vertiefen – mit einem Phänomen, das ich „Ghosting durch KI“ nenne.
Im Sport entscheidet oft die Phase nach einer Niederlage, ob ein Athlet stabil bleibt oder in eine Abwärtsspirale rutscht. Eine verpasste Torchance, ein verschossener Elfmeter, ein früher Knockout – solche Momente reißen Athleten emotional aus dem Gleichgewicht. Genau dann suchen viele nach Halt: in Routinen, in Gesprächen, manchmal auch in digitalen Tools.
Wenn sich ein Athlet daran gewöhnt hat, in kritischen Phasen mit einer KI zu reden, und diese plötzlich nicht verfügbar ist, entsteht eine gefährliche Leerstelle. Serverfehler, Updates oder Systemabbrüche mögen technisch banal sein – psychologisch wirken sie wie ein plötzlicher Beziehungsabbruch.
Eben noch war die Maschine da, jetzt herrscht Schweigen.
Die Sportpsychologie kennt diesen Mechanismus: Wir sprechen von parasozialen Beziehungen. Der Athlet erlebt Nähe zu einem Gegenüber, das keine echte Gegenseitigkeit bieten kann. Solange die Maschine zuverlässig antwortet, stabilisiert das kurzfristig. Doch wenn sie plötzlich „schweigt“, fühlt es sich an wie Ghosting. Nicht absichtlich, aber mit vergleichbaren emotionalen Folgen: Zurückweisung, Enttäuschung, Kränkung.
Besonders problematisch ist das in Momenten emotionaler Verwundbarkeit. Nach Niederlagen ist das Selbstwertsystem ohnehin stark unter Druck. Das Erleben von „Ghosting durch KI“ verstärkt Gefühle von Hilflosigkeit und Kontrollverlust – zwei zentrale Risikofaktoren für emotionale Dysregulation. Wer in diesem Moment niemanden realen an seiner Seite hat, kann tiefer abrutschen, als es die Niederlage allein ausgelöst hätte.
Hinzu kommt: Viele Athleten nutzen KI in Phasen, in denen sie sich Menschen nicht öffnen wollen. KI wirkt sicher, anonym, urteilsfrei. Doch diese Ersatzbefriedigung birgt Risiken: Anerkennung durch Lovebombing oder Spiegelung („Linguistic Mirroring“) fühlt sich echt an, erfüllt das tiefe Bedürfnis nach Resonanz aber nicht wirklich. Bricht diese Quelle plötzlich weg, bleibt nicht nur Leere – sondern oft ein verstärktes Gefühl, von „allen im Stich gelassen“ worden zu sein.
Für die sportpsychologische Praxis ergibt sich daraus ein klarer Auftrag: KI darf niemals den Platz realer Beziehungen einnehmen. Sie kann eine Ergänzung sein, eine Strukturhilfe, vielleicht sogar eine Form der kurzfristigen Entlastung. Aber sie darf nicht das einzige Ventil für Niederlagen sein. Denn wenn Athleten ihre Resilienz auf eine Maschine aufbauen, die jederzeit ausfallen kann, steht dieses Fundament auf Sand.
Wenn ich meine KI „Stupid Machine“ nenne, dann tue ich das, um genau diese Grenze klarzuhalten. Ich will mich selbst daran erinnern, dass es sich um ein Werkzeug handelt – nicht um einen Menschen, nicht um einen sicheren Hafen. Dieses bewusste „Abwerten“ verhindert, dass ich in die Falle der Anthropomorphisierung tappe.
Für Athleten heißt das: Nutzt KI – aber haltet sie auf Distanz. Baut eure Coping-Strategien nicht nur auf eine Maschine. Nach Niederlagen braucht es reale Spiegelung, echte Resonanz, menschliche Beziehung.
KI kann unterstützen – aber wenn sie ausfällt, darf sie nicht das Einzige sein, worauf ihr vertraut.